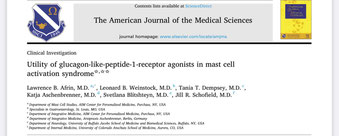
Dr. Aschenbrenner ist Co-Autorin der Studie "Utility of glucagon-like-peptide-1-receptor agonists in mast cell activation syndrome" veröffentlicht in "The American Journal of the Medical Sciences"
Heute gibt es tolle Nachrichten!
Zusammen mit einer Gruppe von renommierten amerikanischen MCAS-Forschern und sehr erfahrenen MCAS-Ärzten haben wir eine Studie zur Wirksamkeit von GLP-1-Rezeptor-Agonisten (“Abnehmspritzen”) bei Patienten mit Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS) durchgeführt. Mit Ergebnissen, die Hoffnung machen!
Es freut mich außerordentlich, dass unsere Studie vom renommierten „The American Journal of the Medical Sciences“ zur Publikation angenommen wurde. Es war mir eine besondere Ehre, mit dem MCAS-Pionier und einem der Erstbeschreiber der Krankheit überhaupt, Dr. Lawrence Afrin, zusammenzuarbeiten.
Die Publikation finden Sie hier.
Hier eine verständliche Zusammenfassung der Studienergebnisse:
Was ist ein Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS)?
Das Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS) ist eine Erkrankung, bei der Mastzellen, die normalerweise an der Immunantwort und der Bekämpfung von Infektionen beteiligt sind, übermäßig aktiv werden. Diese Überaktivität führt dazu, dass die Mastzellen vermehrt Botenstoffe (Mediatoren) freisetzen, die Entzündungsreaktionen und allergieähnliche Symptome an den unterschiedlichsten Stellen im Körper auslösen können. Leider ist das gar keine seltene Erkrankung, sondern man geht davon aus, dass 17-20 % der Bevölkerung von MCAS betroffen sind.
Die Symptome können sehr vielfältig sein und verschiedene Organsysteme betreffen, wie z.B. Haut (Ausschläge, Juckreiz), Magen-Darm-Trakt (Durchfall, Übelkeit, Unverträglichkeiten), Herz-Kreislauf-System (Blutdruckabfall, Herzrasen), Atemwege (Atemnot) u.v.a.m.
Warum ist diese Studie so wichtig?
Beim Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS) können die Beschwerden von Person zu Person sehr unterschiedlich sein. Typischerweise leiden Betroffene aber dauerhaft an vielerlei Symptomen in mehreren Organsystemen gleichzeitig.
Gerade weil MCAS sich so vielfältig zeigen kann, ist es schwierig, für jede einzelne Patientin und jeden Patienten sofort die bestpassende Behandlung zu finden.
Wir haben deshalb geprüft, ob eine bereits bekannte Medikamentenklasse, sogenannte GLP-1-Rezeptoragonisten, die man eigentlich gegen Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit einsetzt, auch bei MCAS helfen kann. Diese Medikamentenklasse ist besser unter den Handelsnamen wie Ozempic® (Semaglutid) oder Mounjaro® (Tirzepatid) bekannt, umgangssprachlich werden sie meist einfach die „Abnehmspritze“ genannt.
Was haben wir gemacht?
Es wurden 47 MCAS-Betroffene (15–71 Jahre, 89 % Frauen), die unterschiedliche GLP-1-Medikamente erhielten (weil andere Behandlungsversuche nicht genug Erfolg gebracht hatten), beobachtet.
Die wichtigsten Ergebnisse
- 89 % der Studienteilnehmer spürten eine deutliche Besserung der Beschwerden, z. B. weniger Schmerzen, weniger Magen-Darm-Probleme, weniger Erschöpfung (Fatigue), weniger allergische Symptome, stabileres Gewicht.
- Positive Effekte zeigten sich oft schon innerhalb weniger Tage.
- Größere Nebenwirkungen traten nur selten auf.
Was bedeutet das?
GLP-1-Rezeptoragonisten könnten für viele MCAS-Patientinnen und Patienten ein neuer Therapiebaustein sein. Bevor sie breit eingesetzt werden, braucht es jedoch größere klinische Studien, um die gezeigte Wirksamkeit zu bestätigen und die beste und sicherste Dosis herauszufinden.
Wieso wirkt die “Abnehmspritze” bei MCAS?
Interessanterweise haben die Mastzellen Rezeptoren für GLP-1. Die Wirkstoffe binden also direkt an GLP-1- und/ oder GIP-Rezeptoren auf der Mastzelle. Wahrscheinlich wird damit die Mastzelle stabilisiert und die sog. Degranulation von Mastzellen wird reduziert, es werden also nicht mehr so häufig und/ oder unkontrolliert Botenstoffe ausgeschüttet. Das wirkt im Endeffekt entzündungshemmend.
Meine US-Kollegin Dr. Tania Dempsey schreibt hier folgendes zu dem möglichen Wirkmechanismus:
"Interestingly, your mast cells have GLP-1 and GIP receptors on their surface – meaning drugs like Semaglutide and Tirzepatide can bind directly to them and influence their behavior.
When these medications bind to GLP-1 receptors on mast cells, they help stabilize the cells by reducing what’s referred to as degranulation – the process by which mast cells release signalling molecules that spark inflammation. Similarly, activating GIP receptors enhances insulin sensitivity and lowers oxidative stress – both of which further help pump the brakes on inflammation.
This combination of effects soothes mast cell activity and limits their degranulation. This remarkable ability to minimize mast cell degranulation and keep these highly evolved cells in a more calm state may make medications like Semaglutide and Tirzepatide a powerful tool in managing conditions with overactive mast cells, such as Mast Cell Activation Syndrome (MCAS)."
Haben Sie noch Fragen zu der Studie?
Schreiben Sie gerne einen Kommentar unter diesen Blog auf LEBENDIG LANG LEBEN, auf der Facebook-Seite von Lebendig Lang Leben oder auf Instagram oder folgen Sie mir auf Twitter @DrAschenbrenner.
Abonnieren Sie am besten den Blog LEBENDIG LANG LEBEN gleich hier! So verpassen Sie nichts und die neuen Ausgaben kommen direkt in Ihr Email-Postfach.
Ihre Dr. med. Katja Aschenbrenner aus Berlin
🔆 DIE GANZHEITLICHE ÄRZTIN 🔆
Mehr Informationen zur Arztpraxis von Frau Dr. Aschenbrenner finden Sie hier.
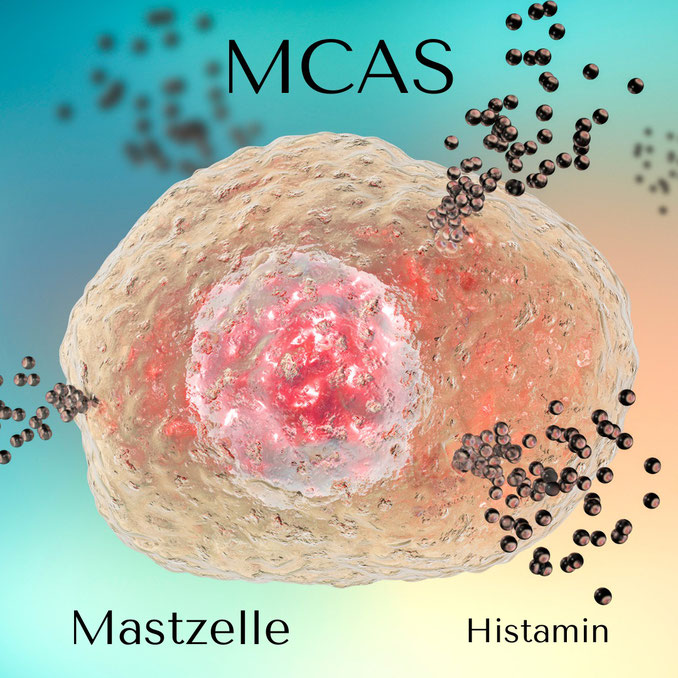
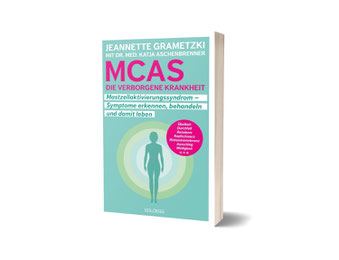
Werbung: Kennen Sie schon das gemeinsame Buch von Frau Grametzki und mir zum Thema „MCAS - die verborgene Krankheit“ (erschienen im Goldegg-Verlag)?
Das Buch ist ein Ratgeber für Betroffene, in dem Jeannette Grametzki ihren eigenen Leidensweg bis zur Diagnose dieser noch relativ unbekannten Krankheit aus Sicht einer Betroffenen schildert. Ich berichte von meinen Erfahrungen aus der täglichen Behandlung von Patienten mit MCAS bzw. Histaminintoleranz und erkläre in einfacher Form das medizinisch Wissenswerte.
Wichtiger Hinweis: Die Blog-Beiträge dienen der allgemeinen Weiterbildung und Information. Sie können und sollen in keinem Falle die ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung ersetzen. Sie sollten daher die hier bereitgestellten Informationen nicht als alleinige Quelle für gesundheitsbezogene Entscheidungen verwenden. Bei Beschwerden sollten Sie auf jeden Fall ärztlichen Rat einholen.
